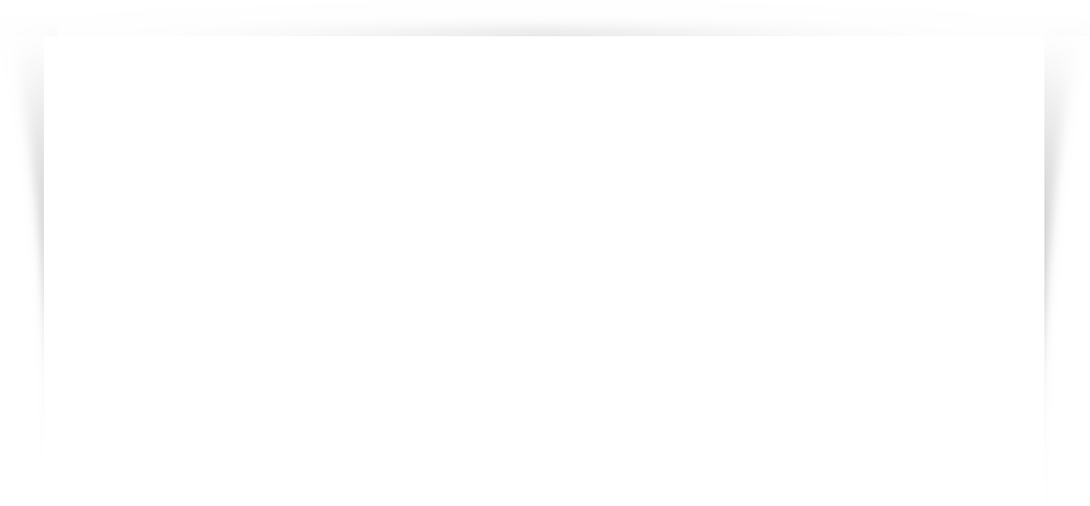
Sechster Sinn (Hypothese)
Bruno Krüger • Sours-Allee 3a • 55276 Dienheim 18.03.2015 Sechster Sinn (Hypothese) ⇒ Dieser Artikel behandelt den Begriff des Sechsten Sinns unter einem funktionalen, neurologischen Gesichtspunkt. Als Ausgangspunkt der Überlegung wird die Evolution des Gehirns vom urzeitlichen Hirnstamm zum modernen Großhirn angenommen. Im Gegensatz zu den fünf Sinnen Tasten, Riechen, Schmecken, Sehen und Hören gibt der „Sechste Sinn“ uns auf unbewusster Ebene Auskunft darüber, ob eine Situation gut oder schlecht für uns ist (Quelle: Wissen.de Artikel „Dem Sechsten Sinn auf der Spur“). Damit verbindet sich der Sechste Sinn mit einer aus dem Diffusen in das Bewusstsein vorrückenden Wahrnehmung, die man auch als Intuition bezeichnet und mit weiter eingrenzenden Begriffen verbindet wie Bauchgefühl, gefühltes Wissen, dunkle Ahnung, unerwartetes Erkennen und der Gabe zu einer sehr schnellen Unterscheidung zwischen Wahrheit und Täuschung. Inhaltsverzeichnis 1 Einordnung 2 Gehirnareale für Angst und Glück 3 Somatische Stimuli 4 Lernen an der Schnittstelle zwischen den Hirnbereichen 5 Emotionen 6 Dichotomie als Quantensprung der Gehirn-Entwicklung 7 Sechster Sinn als Begleiter höherer Intelligenz 8 Deutung von Bewusstsein und Ich Einordnung Die Präsenz von Sechstem Sinn und Intuition in unserer Wahrnehmung wird auf die funktionale Erschließung neuer Gehirnteile im Rahmen der Evolution zurückgeführt. Als Hypothese vorausgesetzt wird, dass der Motor dieser Entwicklung zum einen im Zugewinn an Nutzen für das Leben und Überleben liegt und dass es einen in der Evolution weichenstellenden Verzweigungspunkt geben muss, der die Basis für einen grundlegenden Entwicklungssprung bietet. Zum zweiten wird angenommen, dass eine elementar neuartige Verzweigung in der Evolution nur erfolgreich sein kann, wenn sie mit einer funktionalen Dichotomie verbunden ist. Das führt zu der Hypothese, dass der Startpunkt für eine neuronale Neuentwicklung in Richtung des Säugetiergehirns auf einer Verzweigung in zwei zueinander komplementäre Schnittstellen zwischen urzeitlichem Hirnstamm und werdendem Großhirn zurückzuführen ist. Gehirnareale für Angst und Glück Oberhalb des Hirnstamms schließt sich das Limbische System an. In der Evolution entstand das Limbische System in der Phase der Entwicklung der Säugetiere. Darum wird es auch als Säugerhirn bezeichnet, da es allen Säugetieren gemein ist. Es reguliert die für die soziale Natur der Säugetiere typischen Empfindungen wie Sorge um den Nachwuchs, Angst, Liebe, Lust, Spieltrieb und das Lernen durch Nachahmen. Unter funktionalen Gesichtspunkten werden heute die Amygdala und der Nucleus accumbens zum Limbischen System gezählt. (Quelle: www.Gehirnlernen.de). Sechster Sinn Die Amygdala ist wesentlich an der Entstehung der Angst beteiligt und spielt allgemein eine wichtige Rolle bei der emotionalen Bewertung und Wiedererkennung von Situationen sowie der Analyse möglicher Gefahren. Sie verarbeitet externe Impulse und leitet die vegetativen Reaktionen dazu ein. Der Nucleus accumbens, auch als Glückszentrum bezeichnet, spielt eine zentrale Rolle im mesolimbischen System, dem „Belohnungssystem“ des Gehirns sowie bei der Entstehung von Sucht. Das mesolimbische System ist sehr stark in emotionale Lernprozesse eingebunden. Im Nucleus accumbens befinden sich Dopaminrezeptoren, deren Stimulation durch die dopaminergen Afferenzen (empfindliche Eingangsschnittstellen für Reize und Botenstoffe) aus dem Mittelhirn für die Erwartung eines Glücksgefühls verantwortlich gemacht wird – nicht für das Glücksgefühl selber. (Quelle: www.wikipedia.de). Es spricht vieles dafür, dass sich Amygdala und Nucleus accumbens als die Hirnregionen identifizieren lassen, aus denen heraus komplementäre Schnittstellen zwischen urzeitlichem Hirnstamm und werdendem Großhirn über die Evolution entwickelt wurden. Auf einer semantischen Ebene entstehen daraus die komplementären Konzepte „Angst“ und „Glück“. Funktional lässt sich daraus ableiten, dass der Körper (genauer: sein Reptiliengehirn) Auskunft darüber gibt, ob eine „somatische“ Situation als gut oder schlecht einzuschätzen ist. Für jede Richtung steht eine der beiden komplementären Schnittstellen zur Verfügung. Somatische Stimuli Neuronale Netze sind als geschlossene Systeme zu betrachten, deren Semantik nur intern in Erscheinung tritt und sich einer direkten Beobachtung von außen verschließt. Das gilt selbstverständlich auch für die neuronalen Elemente Amygdala und Nucleus accumbens. Die Begriffe „Angst“ und „Glück“ führen daher schon einen Schritt zu weit, da diese mit weitreichenden Bedeutungszusammenhängen unseres Denkens verknüpft sind. An den Anfang der Überlegung soll daher eine funktionale Betrachtung gestellt werden, mit der ein einleuchtender Nutzen für das Überleben durch höhere Intelligenz zu erkennen ist. Der Start der Evolution in eine neuronale Neuentwicklung setzt voraus, dass ein Überleben am Anfang der Entwicklung auch ohne das neu Hinzukommende gesichert ist, ein Überleben ohne Großhirn. Funktional leistet der Hirnstamm dazu auch eine ausreichende Vernetzung zwischen Sensorik und Motorik. Die generelle Fähigkeit, Änderungen der Umgebung zu registrieren und Wechselwirkungen mit dem Umfeld mitzugestalten, ist prinzipiell bereits im Hirnstamm realisiert. Dort werden vegetative Lebenserhaltung sowie aktive Nahrungssuche und Flucht-oder-Kampf-Verhalten sowie die dazu erforderliche Lernentwicklung für Mustererkennung und Handlungsabläufe realisiert – auf dem kognitiven Niveau eines Reptils. Ohne die gefundenen komplementären Schnittstellen beschränkt sich der Nutzen einer zunehmenden Gehirngröße auf die Schaffung erweiterter Spielräume für komplexere Vernetzungen. Diesem graduell zunehmenden Nutzen scheinen allerdings nach heutigem Wissen Grenzen gesetzt zu sein. Danach ist die Größe des Gehirns kein Maßstab für Intelligenz. Über Amygdala und Nucleus accumbens wird allerdings tatsächlich ein neuartiger Nutzen für das Großhirn erschlossen. Den im Hirnstamm angelegten Erkennungs- und Handlungsmustern können unterstützende Hirnaktivitäten des Großhirns an die Seite gestellt werden. Kennzeichnend ist, dass diese neuerdings in zwei komplementäre Richtungen verzweigen und so zum Schlüssel für eine Differenzierung getrennter Alternativen im Denken werden. Im Grunde erschließt dieser Evolutionsschritt nichts Geringeres als die Möglichkeit, Wahrnehmungs- und Handlungsalternativen als Informationen zu verarbeiten, sozusagen digitalisiert und mit zunehmenden kognitiven Fähigkeiten auch unabhängig von Zeit und Raum. An der Schnittstelle zwischen Hirnstamm und Großhirn genügen dafür zwei Arten somatischer Stimuli, welche tief in das Großhirn eindringen und damit systematisch auf die Verstärkung oder Dämpfung aktueller Hirnaktivitäten einwirken. Es wird angenommen, dass dabei viele von zunächst nur schwach oder latent in Bereitschaft stehenden Reizleitungen einen gleichzeitigen Impuls erfahren. Zur Summe ihrer jeweils im Umfeld gestarteten Reize kommt zu diesem Zweck ein zentral erzeugter durchsetzungsstarker somatischer Stimulus hinzu. 2 Sechster Sinn Lernen an der Schnittstelle zwischen den Hirnbereichen Die Schnittstelle zwischen Hirnstamm und Großhirn wird wesentlich durch die Stimuli-Konzepte „gut“ und „schlecht“ gesteuert. Die Schnittstelle zwischen den Hirnbereichen ist aber erheblich breiter und erlaubt eine tiefgreifende gegenseitige Vernetzung. Dabei werden in den Hirnbereichen parallel laufende Aktivitäten kontinuierlich verknüpft. Ausgangspunkt der Evolution des Großhirns ist dabei die Vernetzung zwischen Sensorik und Motorik, die erst einmal durch den Hirnstamm dominiert wird. Dort gelangen einfache Reflexbögen zur Wirkung, die sensorische Eingangsreize aus der Umwelt mit motorischen Ausgangsreizen für die Handlungen des Körpers verbinden. Mit zunehmender Vernetzung in das Großhirn hinein können Module der anfangs primitiven Reflexbögen im ersten Schritt begleitet und dann mit zunehmender Leistungsfähigkeit gezielt durch das Großhirn beeinflusst werden. Es wird vermutet, dass unterschiedliche Rahmenbedingungen eine plastische Umgestaltung der Verbindungen zwischen den Hirnbereichen begünstigen. Eine Rolle dürfte die räumliche Nähe der Neurone spielen, die empfänglich für die Anbindung neuer Synapsen sind. Eine Rolle dürfte aber auch die Durchsetzungsstärke spezialisierter Hirnareale mit weit verzweigten eingehenden und ausgehenden Synapsenverbindungen spielen. Bevor leistungsstarke Großhirnaktivitäten zu erwarten sind gilt allerdings das Zufallsprinzip, welches frühes Lernen auf Versuch-und-Irrtum beschränkt. Dabei wird die Bedeutung der steuernden somatischen Stimuli erlernt. Es wird angenommen, dass die somatischen Stimuli heraufziehende Situationen anzeigen, zu denen der Hirnstamm bereits passende primitive Reflexbögen in Stellung gebracht hat. Dabei üben die Stimuli in Richtung Großhirn lediglich einen antreibenden Einfluss aus und vermitteln eine Art „Vorwärts-Kommando“. Ein Durchzünden primitiver Reflexbögen wird genau dann verhindert, wenn auf kognitiver Ebene des Reptils eine durchgreifende Änderung der Situation erkannt wird, aus der heraus der Hirnstamm den Handlungsbedarf wieder herunter stuft. In der aufkeimenden Phase einer erst schwach erkannten Situation sind primitive Reflexbögen demnach durch Aktivitäten des Großhirns und eine intelligentere Reaktion abzuwenden. Dabei können mehr oder weniger zufällige Aktivitäten am Anfang der Lernphase des Großhirns auch mit schwacher Wirkung zum Erfolg führen und dann im Laufe von späteren Wiederholungen in ähnlichen Situationen gefestigt werden. Am Ende einer Lernphase können daraus dominante Einflüsse des Großhirns werden, die sich gegenüber den Modulen primitiver Reflexbögen durchsetzen. Emotionen Gedächtnis zur Speicherung von relevantem Wissen ist nach modernen Erkenntnissen über das gesamte neuronale Netz verteilt. Daher ist es interessant zu wissen, wie in einer bestimmten Situation die richtigen Wissensbrocken zusammengeführt werden. Beim Start der Evolution in die Entwicklung des Großhirns nimmt alles das, was für das Überleben wichtig ist, seinen Ursprung in den Wissensbrocken des Hirnstamms. Diese werden aber nicht nur dann aktiv, wenn primitive Reflexbögen durchgezündet werden, sondern schon dann, wenn sich der Hirnstamm auf eine drohende Gefahr oder einen anderen Handlungsbedarf vorbereitet. Mit tief in das Großhirn wirkenden Stimuli können sich dadurch Bereiche des Großhirns, die sich später in eine thematische Nähe zu den sensorischen oder motorischen Wissensbrocken des Hirnstamms hin entwickeln, bemerkbar machen. Allein paralleles Aktiv-sein begünstigt dabei die Chance, in einer später ähnlichen Situation erneut eingebunden zu werden. Lernen erfolgt dann über Wiederholungen von ähnlichen Reizleitungssituationen. Wie alles andere relevante Wissen auch, sind derartige Reizleitungssituationen der Informationsträger, über den sich komplexe Handlungsbedarfe abbilden. Die somatischen Stimuli erfüllen dabei allein die Funktion eines Verstärkers und vermitteln die nötige Eindringtiefe in das Großhirn. Aber erst die spezielle aktuelle und über alle Hirnbereiche verteilte Reizleitungssituation informiert über die Situation und ist der Schlüssel für eine passende Zusammenführung der richtigen Wissensbrocken. 3 Sechster Sinn Es wird vermutet, dass der in das Bewusstsein vordringende Eindruck von Emotionen ein Ergebnis der dahinter stehenden Lernentwicklung ist. Emotionen werden dabei als fließende Erlebniseindrücke gesehen, die das sogenannte phänomenale Bewusstsein erreichen, das mit diesen einen schnellen Überblick zur Lage gewinnt. Für die Konzentration auf Gefahren oder anderen Handlungsbedarf kommt es auf schnelle Breitenwirkung an und genau das leisten Emotionen. Der Nutzen einer Emotion und ihre Daseinsberechtigung im Sinne der Evolution liegen in ihrer Wirkung. Emotionen projizieren ein Zuordnungswissen, wo entscheidende Wissensbrocken zu finden sind, in eine differenzierte Reizleitungssituation, mit der die passenden Gehirnareale in Stellung gebracht werden. Die beliebig verstreuten Gehirnareale können dann ohne weitere Verzögerungen zu einer Lösung beitragen. Mit dieser Sichtweise wirkt eine Emotion als sechster Sinn, der das Bewusstsein mit guten Ratschlägen erreicht. Eine gute Emotion kann daran gemessen werden, wie originalgetreu eine Ausgangslage wiederhergestellt werden kann, die schon einmal zu einer Lösung beigetragen hat. Dichotomie als Quantensprung der Gehirn-Entwicklung Mit den somatischen Stimuli kommt ein antreibendes Element ins Spiel, welches mit hoher Durchsetzungskraft aus schwach aufkeimenden Reizleitungssituationen Tiefenwirkung produziert. Es wächst Spielraum, mit tiefergehenden Reizleitungen an möglicherweise nützliche Hirnareale heranzukommen und zugleich Stabilität und Zwischenspeicherung von Zuständen zu erzielen. Dies zeigt sich etwa in Rückkopplungen auf den Eingang einer Reizquelle. Die Konsequenz ist, dass dem Gehirn erheblich mehr Zeit und Spielraum gegeben wird, komplexe Verknüpfungen zu finden, die zu einer Lösung beitragen. Solange sich ein Lebewesen ausschließlich im Jetzt organisiert genügt eine einfache Nahrungs- und Gefahr-sensible Sensorik, die Reflexbögen in Stellung bringt. Diese werden dann von einer einzigen Art an somatischem Stimulus durchgezündet. Es genügt sozusagen ein einfaches Vorwärts-Kommando. Gut ist, was dem Überleben im Jetzt hilft. Schlecht gibt es nicht. Ein Mehr an Tiefenwirkung im Gehirn und ein Mehr an komplexem Verhalten war die Voraussetzung für die Entwicklung der Säugetiere. Dies führte zum Sprung in eine neue Selbstorganisation, die sich nicht mehr auf das Jetzt beschränkte. Die höhere Komplexität wurde einerseits durch einen verstärkten Antrieb durch somatische Stimuli ermöglicht. Antreiben, aber wohin? Es ist eine einfache Weisheit, dass es keine noch so gute Richtung gibt, in die man gehen oder sich entwickeln kann, zu der es nicht irgendwann eine Alternative gibt, die entscheidend besser ist. Gleichzeitig ist klar, dass das Umschwenken auf alternative Handlungsstränge eine Vorbereitung voraussetzt. Und genau das ist der springende Punkt, an dem die Dichotomie der komplementären Stimuli für gut und schlecht ins Spiel kommt. Aus dem einfachen „Vorwärts“ des Reptilien-Gehirns werden zwei Kommandos: „Vorwärts, Gutes nutzen“ und „Vorwärts, Schlechtes abwehren“. Aufgabe des Bewusstseins ist es dabei, für Ausgleich zu sorgen und die Handlungen auf eine der Alternativen zu konzentrieren, sofern ein Zielkonflikt zwischen den somatischen Kommandos droht. Als Anhaltspunkt und Steuerungsziel wird die Balance zwischen den somatischen Stimuli vermutet. Daraus entsteht ein Regelkreis. Zu viel Aktivität unter „Gutes nutzen“ führt irgendwann zu Nachteilen und weckt den entgegen wirkenden Angst-Stimulus. Hinreichende Aktivität unter „Schlechtes abwehren“ führt schließlich zu einer verbesserten Situation mit Glücks-Stimulus. Sechster Sinn als Begleiter höhere Intelligenz Die Vorstellung von einem Regelkreis, der die somatischen Stimuli in einem gegenseitigen Gleichgewicht hält, kann als in sich abgeschlossen gesehen werden. Ein höherer Nutzen wird bereits mit der selbstorganisierenden Beherrschung komplexer Handlungsalternativen erreicht. Ein Hinweis auf einen darauf aufbauenden, weiterführenden Evolutionsschritt spiegelt sich im Bild vom Sechsten Sinn als Ratgeber. Aber für was? Vermutet wird, dass ab hier der Einstiegspunkt zu finden ist, ab dem sich höhere Daseinsformen und Intelligenz entwickeln. 4 Sechster Sinn Deutung von Bewusstsein und Ich Die Wege der Reizleitungen im Gehirn bilden das Gedächtnis. Dabei stehen sich Datenverarbeitung und Ausgangskontrolle als komplementäre Teilprozesse gegenüber. Die Datenverarbeitung nutzt die Sensorik und folgt den Signalen aus der Außenwelt. Die Ausgangskontrolle ist Ergebnis der Motorik und geht dem Wirken in der Welt voran. Neben jeweils vorwärts gerichteter Datenverarbeitung und Ausgangskontrolle werden alle gleichzeitig rückwärts gerichteten neuronalen Reizleitungen als interpretierende Instanz gesehen. Diese ermöglicht erst die Fähigkeiten der Mustererkennung und den Abruf gespeicherter und differenzierbarer Datenelemente (Quelle: www.kruegergold.de/texte/gedaechtnis.pdf). Lebewesen sind selbstorganisierende und von einem Außen abgegrenzte komplexe Strukturen. Der Grad an Selbstorganisation wird bestimmt durch das neuronale Netzwerk eines Lebewesens. Hier gibt es eine Symmetrie, die im Grad der Komplexität liegt. Der Grad an Selbstorganisation, den die Außenwelt in einem Lebewesen erkennen kann, kann als symmetrisch gesehen werden zur Komplexität des Gehirns und seiner Fähigkeit, die Außenwelt abzubilden. Das Selbst eines Lebewesens kann in dieser Vorstellung als die oben eingeführte innere Interpretationsinstanz im Gehirn gesehen werden. Aus der Sicht dieser Instanz gibt es eine funktionale Symmetrie von Eingang und Ausgang. Am Eingang werden Daten und Signale aus der Außenwelt verarbeitet. Am Ausgang werden die Handlungen des Lebewesens in der Welt kontrolliert. Abgeleitet aus einem Theorem zur Symmetrie gilt, dass zu jeder Symmetrie eine Erhaltungsgröße gehört (www.kruegergold.de/texte/symmetrie.pdf). In einer semantischen Deutung dieser Anschauung kann das Selbst bzw. die interpretierende Instanz mit dem Begriff des Unterbewusstseins gleichgesetzt werden. In diesem Bild werden eigenständige Person und ihr Selbstverständnis zu einer passenden Erhaltungsgröße. Reflexbögen zwischen Sensorik und Motorik werden dann durch eine mit dem Unterbewusstsein verkoppelte Filterung beeinflusst. Filterung bedeutet dabei, dass Signalwege und Reizleitungen angepasst werden. Auf der Seite der Sensorik werden Signal-Bedeutungen normiert, die zur Ich-Erfahrung der Körperhülle passen. Auf der Seite der Motorik werden Handlungsroutinen, die zu Plänen passen oder nicht passen, mehr oder weniger gewollt. Bild: Unterbewusstsein prägt eigenständiges äußeres Verhalten einer Person in der Welt 5 Sechster Sinn 6 Das Prinzip der Symmetrie lässt sich wie beschrieben zum einen auf das von außen sichtbare Verhalten eines Lebewesens anwenden. Mit diesem Bild einer Symmetrie läßt sich der Grad seiner Selbstorganisation und damit eine Einordnung seiner Persönlichkeit in ein Gesamtumfeld erkennen. Ordnungsstiftendes und verbindendes Element ist in diesem Bild das Unterbewusstsein. In ein komplementäres Bild einer Symmetrie lässt sich zum anderen auch der Sechste Sinn als verbindendes Element einfügen. Der in den vorangegangenen Abschnitten behandelte Regelkreis, welcher die Balance zwischen „Gutes nutzen“ und „Schlechtes Abwehren“ stabilisiert, wäre die zuzuordnende Erhaltungsgröße. Physikalisch soll diese Erhaltungsgröße als eine beinahe-stabile Resonanzerscheinung auf Grundlage rückgekoppelter Reizleitungen gedeutet werden. In einer noch weiterführenden Deutung könnte als physikalischer Effekt aus allen Reizleitungen im Ergebnis eine stehende dreidimensionale elektromechanische Welle vermutet werden. Diese stehende Welle wäre das im Jetzt abgebildete Bewusstsein. Bewusstes Denken generiert dann den bewussten Anteil der im vorangegangenen Bild dargestellten Ich-Erfahrungen sowie den bewussten Anteil der Pläne eines Ich. In Abgrenzung zur Aufgabe des Unterbewusstseins, welches den hohen Grad an Parallelverarbeitung im Gehirn organisiert, fällt dem Bewusstsein die Rolle einer kontinuierlichen Stabilisierung zu. Damit erklärte sich indirekt auch das Ich als dauerhaftes Wissen eines Lebewesens über die Struktur und Ordnung seines Körpers. Mit den vorangegangenen Abschnitten wurde dargestellt, dass die neuronalen Signale, die von Nucleus accumbens und Amygdala in das Gehirn gefeuert werden, somatisch, also vom Körper geprägt sind. Unabhängig von der semantischen Signalisierung von Glück oder Angst ist beiden Signalarten gemeinsam, dass sie somatische Informationsinhalte transportieren. In der Lernentwicklung eines Lebewesens wird mit diesen Informationen gewissermaßen ein ewiges Körper-Wissen aufgebaut. Bild: Bewusstsein als Effekt einer an Körper-Wissen gekoppelten neuronalen Resonanz Bruno Krüger, im März 2015
© Copyright 2026